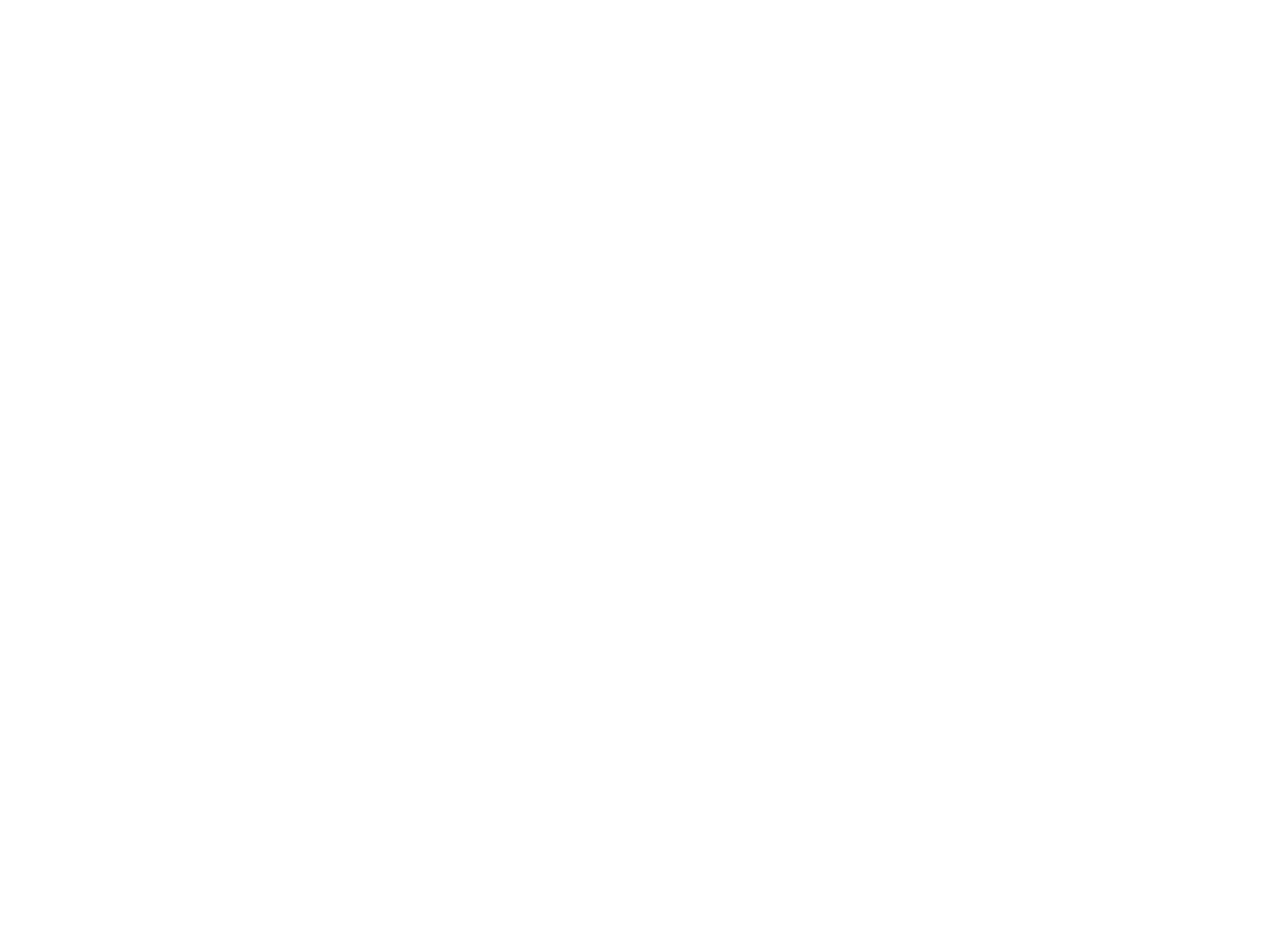Diese scheinbar harmlosen Alltagssätze können dein Kind stark verunsichern
Alltagssätze fallen mal so nebenbei, doch gerade Eltern sollten achtsam sein, denn harmlos scheinende Sätze verunsichern dein Kind leicht.

Alle Eltern werden das wohl kennen: Du meinst es gut, sagst etwas schnell dahin – und merkst erst später, dass dein Kind ganz still wird oder sich zurückzieht. Viele Sätze, die wir im Alltag benutzen, klingen harmlos. Aber für ein Kind können sie wie kleine Nadelstiche wirken und auf Dauer stark verunsichern. Im schlimmsten Fall wächst es mit dem Gefühl auf, ungeliebt zu sein. In diesem Artikel schauen wir uns typische Beispiele für Alltagssätze an – und was sie bei Kindern auslösen können.
Beginnen wir mit einem Klassiker, den wir wohl gehört haben und nun auch mal unseren Kindern sagen:

Satz #1: „Ist doch nicht so schlimm!“
Warum dieser Satz verunsichert:
Kinder nehmen Gefühle sehr ernst. Wenn du sagst, „ist doch nicht so schlimm“, fühlt sich dein Kind mit seinem Kummer nicht ernst genommen. Es lernt: Meine Gefühle sind übertrieben oder sogar falsch und lernt nicht, auf sie im Zweifel zu hören.
Was du stattdessen sagen kannst:
„Oh, das hat dich echt traurig gemacht. Erzähl mir mehr.“
So stärkst du das emotionale Vertrauen des Nachwuchses und bringst ihm bei, dass seine Gefühlsäußerungen wichtig und richtig sind.
Auch der nächste Satz rutscht mal eben so raus:

Satz #2: „Jetzt sei doch mal lieb!“
Warum dieser Satz verunsichert:
„Lieb sein“ klingt nach einer Bedingung für Zuneigung. Kinder verstehen das schnell als: Ich bekomme nur Liebe, wenn ich mich „richtig“ verhalte. Das kann ein tiefes Unsicherheitsgefühl auslösen. Außerdem lernen sie, dass sie ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse unterdrücken sollen, um Zuneigung verdienen zu dürfen.
Alternative:
„Ich sehe, du bist gerade wütend. Das ist okay. Lass uns überlegen, wie wir damit umgehen können.“ Wut zu äußern ist in Ordnung. Das sollten auch Kinder früh lernen.
Aber auch im nächsten Satz steckt viel versteckter Schmerz für Kinder:

Satz #3: „Das schaffst du sowieso nicht!“
Warum dieser Satz verunsichert:
Auch wenn er scherzhaft gemeint ist, sollte man diesen Satz nicht sagen, da Kinder ihn wörtlich nehmen. Die Botschaft, die ankommt: Du bist nicht gut genug. Das kann die Motivation und das Selbstwertgefühl nachhaltig schädigen.
Besser wäre:
„Das ist ganz schön knifflig – aber ich traue dir zu, dass du es schaffst. Ich helfe dir, wenn du willst.“ Damit zeigst du deinem Kind, dass du an seine Fähigkeit glaubst, aber gleichzeitig, dass es okay ist, um Hilfe zu bitten und anzunehmen.
Den nächsten, scheinbar harmlosen Satz kennen wir doch alle, oder?

Satz #4: „Du machst mich noch wahnsinnig!“
Warum dieser Satz verunsichert:
Eltern dürfen überfordert sein. Auch deine Gefühle sind valide. Aber Kinder fühlen sich schnell verantwortlich für die Stimmung und denken, dass ihre Bedürfnisse eine negative Auswirkung haben. Dieser Satz vermittelt: „Ich bin schuld, wenn Mama/Papa sich schlecht fühlt.“
Hilfreicher wäre:
„Ich bin gerade sehr gestresst. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich brauche nur kurz Ruhe.“ So bringst du deinen Kindern nicht nur bei, dass du deine Grenzen wahrnimmst und schützt, sondern zeigst ihnen auch eine gute Alternative zum Umgang mit Stress, der ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg weiterhelfen kann.
Noch tragischer ist aber der nächste Satz:

Satz #5: „Wenn du das machst, hab ich dich nicht mehr lieb.“
Warum dieser Satz verunsichert:
Dein Kind lernt durch diesen Satz etwas wirklich Trauriges: Die elterliche Liebe wird an Bedingungen geknüpft. Für ein Kind ist das kein Spaß, sondern existenziell bedrohlich. Es kann Ängste entwickeln, verlassen zu werden, nur weil es einen Fehler gemacht hat. Der stört die Bindungsfähigkeit.
Alternative:
„Ich mag nicht, was du da gerade machst – aber ich hab dich immer lieb.“ Auch wenn du wütend bist, solltest du deinem Kind immer vermitteln, dass Wut, Trauer und auch Enttäuschung nichts an der Liebe zwischen Eltern und Kind ändern kann.
Auch den nächsten Satz solltest du vermeiden:

Satz #6: „Jetzt stell dich nicht so an!“
Warum dieser Satz verunsichert:
Kinder spüren, wenn sie überfordert oder ängstlich sind. Wenn sie jammern oder weinen, wollen sie meist nur, dass man ihnen Hilfe anbietet und brauchen in jedem Fall Unterstützung. Solche Sätze entwerten ihre eigene Wahrnehmung und lehren sie, sich selbst zu misstrauen.
Besser:
„Ich sehe, das ist dir gerade unangenehm. Wollen wir gemeinsam schauen, wie wir’s leichter machen?“ Indem du deinem Kind beibringst, dass es möglich ist, die Perspektive anderer einzunehmen, lernen sie in diesem Moment auch, dass persönliche Wahrnehmung nicht nachvollziehbar sein muss, um respektiert zu werden.
Viele Eltern denken, dass Kinder den nächsten Satz mögen, doch sie liegen falsch:

Satz #7: „Du bist doch schon groß!“
Warum dieser Satz verunsichert:
Manche Eltern denken, dass dieser Satz ein Kompliment ist, doch meist ist der Anspruch an mehr Reife die Ursache für diese Aussage. Kinder können sich hier überfordert fühlen, denn sie glauben, dass sie „funktionieren“ müssen, obwohl sie sich noch klein fühlen. Dieser Satz kann Druck erzeugen und verhindert echtes Wachsen und Reife.
Einfühlsam wäre:
„Du wächst gerade an so vielen Stellen – aber du darfst trotzdem klein sein, wenn du magst.“ Mit diesem Satz gibst du deinem Kind das Gefühl, dass du seine Reife respektierst, aber seine kindliche Bedürfnisse nicht außer Acht lässt.
Bei Geschwistern solltest auch auf diese Sache achten:

Satz #8: „Schau mal, dein Bruder kann das schon.“
Warum dieser Satz verunsichert:
Vergleiche lösen selten Motivation aus. Stattdessen verursachen sie leider eher Scham oder Neid. Kinder fühlen sich abgewertet und ungeliebt. Außerdem können solche Sätze die Beziehung zu der Person, mit der sie verglichen werden, verschlechtern. Besonders für Geschwister kann das tragisch werden. Auch positive Vergleiche sollte man vermeiden.
Stattdessen:
„Jeder hat sein eigenes Tempo. Ich sehe, du gibst dir Mühe – das zählt.“ So zeigst du deinem Kind, dass du seinen Wert nicht an anderen misst.
Kein Elternteil ist perfekt. Und niemand kann jeden Satz immer richtig wählen. Aber ein achtsamer Blick auf unsere Sprache kann viel bewirken – für mehr Nähe, Vertrauen und Selbstsicherheit im Alltag:

Worauf Eltern im Gespräch mit ihren Kind achten sollten
- Gefühle ernst nehmen: Nicht kleinreden („Ist doch nicht so schlimm“), sondern benennen und begleiten.
- Auf Augenhöhe sprechen: Keine Befehlstonart, sondern einladende Formulierungen nutzen.
- Aktiv zuhören: Blickkontakt, nachfragen, ausreden lassen – ohne direkt zu bewerten.
- Ich-Botschaften statt Schuldzuweisungen: „Ich bin gerade gestresst“ statt „Du nervst mich“.
- Geduld zeigen – auch bei Wiederholungen: Kinder brauchen Wiederholung, um Dinge zu verarbeiten.
- Vergleiche vermeiden: Jedes Kind ist anders – und will als Person gesehen werden.
- Lob gezielt und konkret geben: Nicht nur „Toll gemacht“, sondern: „Ich finde super, wie du das durchgezogen hast.“
- Fehler als Lernchance benennen: Kein Drama, sondern gemeinsam überlegen: Was hilft dir beim nächsten Mal?
- Verständnis zeigen, auch wenn das Verhalten schwierig ist: Gefühle erkennen, ohne alles gutzuheißen.